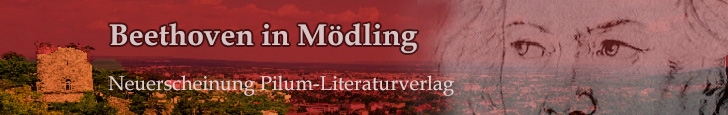Sagitt meint:
Natürlich kann dies keine Götterdämmerung sein. Das was Kaiser im Bereich des Klavierspiels repräsentiert, ist Jürgen Kesting im breich des Gesang. Eine mehrbändige Anthologie über Sänger und eine unebdliche Zahl von Sendungen über Sänger sind Ausweis seiner Kompetenz.
Es könnte interessant sein, sich im Forum darüber einmal auszutauschen, zumal ja einige sehr mit Stimmen beschäftigte und im Gesang bewanderte Menschen sich hier treffen.
Ich fange mit zwei kleinen Aspekte an: Kesting ist ja sehr kritisch, auch ein Fischer-Dieskau wird von ihm nicht verschont. Mein Eindruck ist, das seine Vorliebe eher in der Frühzeit der Gesangskunst liegen, soweit diese Kunst dokumentiert ist ( K. muss eine Unmenge von Aufnahmen kennen/besitzen).
Der zweite Aspekt ist, dass für mich der Liedgesang deutlich zu kurz kommt. Sänger sind für Kesting Opernsänger. Ich hingegen meine, dass sich die Kunstfertigkeit eines Sängers viel eher zeigt, wenn er/sie die Mikroform des Liedes gestalten kann.
Ich bin gespannt,ob wir über Kesting und seine Ansichten in Diskussion kommen.